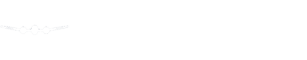schon vergessen ?
ich freu mich jedenfalls schon auf die EU-weit gültige Bezeichnungsverordnung für Winterreifen und bin schon auf die Ausnahmen gespannt
 Bezeichnungsverordnungen [Bearbeiten]
Bezeichnungsverordnungen [Bearbeiten]


Heute findet man im Supermarkt überwiegend die Bezeichnung Konfitüre
Bis zum Erlass der Konfitürenverordnung (KonfV) vom
26. Oktober 1982 in Deutschland wurde der Begriff für Zubereitungen aus zahlreichen Früchten wie
Johannisbeeren,
Kirschen,
Erdbeeren,
Aprikosen/Marillen,
Himbeeren,
Pflaumen,
Birnen,
Äpfeln und anderen verwendet. Der Unterschied zur
Konfitüre bestand darin, dass bei letzterer noch Fruchtstücke erkennbar waren. Man unterschied außerdem Einfrucht- von Mehrfruchtmarmeladen.
Seit der Konfitüren-Verordnung und laut
EU-Vorschrift (Codexkapitel B5 Konfitüre und andere Obsterzeugnisse) dürfen unter der Bezeichnung Marmelade nur noch Fruchtaufstriche aus
Zitrusfrüchten verkauft werden. Dieses ist auf den englischen Einfluss zurückzuführen, denn der englische Begriff
Marmalade bezeichnete schon vorher die besondere britische (
Bitter-) Orangenmarmelade. Die neue Einteilung kann zu Missverständnissen führen, da es keinen Unterschied mehr für die alten Bedeutungen in der Bezeichnung gibt.
Marmelade, zu deren Herstellung keine ganzen Früchte, sondern
Fruchtsaft benutzt wurde, nennt man
Gelee. Natursüße Produkte von ähnlicher Beschaffenheit müssen in Deutschland als „
Fruchtaufstrich“ bezeichnet werden.
Ungeachtet der Verordnung wird in vielen Gegenden die traditionelle Bezeichnung
Marmelade umgangssprachlich beibehalten.
Ausnahmegenehmigung für Kleinerzeuger [Bearbeiten]
Ende 2003 hat die EU-Kommission eine Ausnahmegenehmigung vorgelegt, nach der Kleinerzeuger ihre eingekochten Früchte wie früher als Marmelade bezeichnen dürfen. Diese Gesetzesänderung wurde im Juni 2004 auch vom EU-Parlament bestätigt. Das bedeutet, dass im Inland die bisherige Bezeichnung Marmelade generell erlaubt ist, nur auf Packungen für den Export muss Konfitüre aufgedruckt sein. Dieselbe Ausnahme gilt bereits für
Dänemark und
Griechenland.
Österreich ist ebenso ausgenommen von dieser Regelung, da die Bezeichnung Konfitüre hier nicht üblich ist. Daher dürfen Erzeuger weiterhin die typisch österreichische Bezeichnung verwenden, ähnlich wie bei Paradeisern für Tomaten oder Erdäpfel für Kartoffeln.
Marmeladenrezepte [Bearbeiten]
In Marmeladenrezepten in Kochbüchern wird weiterhin die traditionelle Marmelade beschrieben. Zu diesen Rezepten gehören zum Beispiel auch Mehrfruchtmarmeladen, wie Erdbeer-Apfel-Marmelade und Marmelade aus Sauerkirsche, Stachelbeere und schwarzer Johannisbeere (siehe auch
Opekta).
Verwendung in Mehlspeisen [Bearbeiten]
Die Marmelade ist ein wichtiger Bestandteil der
Österreichischen Küche. So werden
Palatschinken mit Marmelade bestrichen und danach eingerollt. Die
Sacher-Torte wird vor dem Glasieren mit passierter Marillenmarmelade
aprikotiert. Für die
Linzer Torte verwendet man traditionsgemäß
Ribiselmarmelade.
Buchteln können sowohl mit
Powidl als auch mit Marillenmarmelade gefüllt werden, für
Faschingskrapfen ist Marillenmarmelade üblich. Die Fülle von
Punschkrapfen wird ebenfalls unter Verwendung von Marillenmarmelade hergestellt.
Polsterzipfe werden mit Marmelade gefüllt, am beliebtesten dafür ist Ribiselmarmelade. Auch viele Weihnachtskekse können auf Marmelade nicht verzichten:
Linzer Augen beispielsweise bestehen aus zwei Keksscheiben, die mit Ribiselmarmelade zusammengeklebt sind. Für die
Bozner Buchweizentorte wird traditionell
Preiselbeermarmelade verwendet.
[6]
Wissenswertes [Bearbeiten]
- Der Maler Carl Spitzweg sammelte Rezepte, die er oft mit Zeichnungen oder Collagen versah. Für seine Nichte Nina Spitzweg fertigte er eine Reihe von illustrierten Kochrezepten an, die nach seinen Angaben aus mindestens fünf Kochbüchern stammten. Zur „Marmelade aus Erdbeeren“ bemerkte er: Hier gilt dasselbe wie bei der Bereitung von Kirschenmarmelade. Siehe diese.[7]
- Ein Wirt in der Wachau, der sich weigerte, seine Marillenmarmelade „Aprikosenkonfitüre“ zu nennen, löste die „Marillen-Affaire“ aus.[8] Diese führte zu einer Ausnahmeregelung der Bezeichnungsvorschrift.[1]
- In Ostösterreich ist der Scherzname Marmeladinger für Norddeutsche gebräuchlich.
Siehe auch [Bearbeiten]
Literatur [Bearbeiten]
Quellen [Bearbeiten]
Wie schmeckt Ihnen das?
Eigentlich wollte Brüssel eine EU-Rezeptur für alle Lebensmittel vorschreiben. Aber nach dem Frühstück war Schluss
Alois Berger BRÜSSEL. Die Sache mit der Marillenmarmelade hatte auch schöne Seiten: "Da haben alle Österreicher mitgeholfen", schwärmt Frau G., "sogar das Bundeskanzleramt". Frau G. redet nicht vom Einkochen, sondern vom Beschriften. Die Bezeichnung Marillenmarmelade war in der EU bis vor kurzem verboten. Ein Wirt in der Wachau sollte sogar 150 Euro Strafe zahlen, weil er seine Marillenmarmelade nicht EU-korrekt "Aprikosenkonfitüre" nennen wollte. Frau G. musste viel in Brüssel herumtelefonieren, bis das EU-Recht endlich geändert wurde. Jetzt sind regionale Ausnahmen zulässig.
Frau G. sitzt zwischen kunstvoll geschichteten meterhohen Papierstapeln in ihrem Büro in der Brüsseler Kortenberglaan und vertritt die Interessen Österreichs bei der EU. Nicht alleine natürlich: "Wir sind 40 Akademiker im Haus. "Wer nicht mindestens einen Magister oder Dipl. auf der Visitenkarte stehen hat, wird nicht mitgezählt. Österreicher halten auch in der Fremde an ihren Traditionen fest, sowie an der Marillenmarmelade, die man jetzt auch wieder im Ösi-Shop in der Gerardstraat in Brüssel kaufen kann.
Die Marillen-Affäre
Die Marillen haben Frau G. und die 40 Akademiker fast sechs Monate lang auf Trapp gehalten. Laut EU-Richtlinie 79/693/EEC darf Marmelade eigentlich nur aus Zitrusfrüchten gemacht werden, sonst muss sie Konfitüre heißen. Marillen, alias Aprikosen, könnten demnach nie zu Marmelade werden, nur zu Konfitüre. Marillenkonfitüre aber lehnen Österreicher aus Prinzip ab.
Der Unsinn hat einen historischen Hintergrund. 79/693/ECC gehört zu den sieben Frühstücksrichtlinien aus der Lernphase der EU. Denn in den 70er-Jahren glaubten die Politiker, ein gemeinsamer europäischer Markt sei nur möglich, wenn es für alle Lebensmittel ein europaweit einheitliches Rezept gibt - sonst kaufe man eine Salami aus Italien oder eine Wachtelpastete aus Frankreich und wisse nicht, ob die genauso gut ist wie von einem deutschen Metzger.
Aber bis zur Euro-Salami und zur Euro-Wachtelpastete ist die EU nie gekommen. Nach den Richtlinien für Schokolade, Honig, Marmelade, Fruchtsaft, Zucker, Dickmilch und für Kaffee- und Zichorienextrakte war Schluss. Zichorienextrakt ist übrigens Ersatzkaffee aus Chicorée-Gemüse.
In Deutschland wird Muckefuck meist aus gerösteter Gerste gemacht. Deutscher Ersatzkaffee genießt daher ohnehin nicht den Schutz einer EU-Richtlinie und darf theoretisch auch aus Linsen gebrannt werden.
Im Falle des Kaffees ist die Sache eindeutig. Kaffee muss nach Richtlinie 77/436/EWG, später geändert in 99/4/EG, aus gerösteten Kaffeebohnen gemacht werden. Sonst darf er nicht Kaffee heißen. Für Schokolade gilt: mindestens 35 Prozent Kakao, davon 18 Prozent Kakaobutter, Zucker, eine Spur Lecithin, und - wenn es denn sein muss - auch fünf Prozent Palmöl. Allein um das Palmöl wurde jahrelang gestritten, weil Franzosen Schokolade lieber etwas bitterer und weicher mögen, Briten hingegen schätzen sie süßer und härter. Palmöl macht den Unterschied.
In zehn Jahren hat die EU sieben solcher Produktrichtlinien geschaffen und weil die alle mit dem Frühstück zu tun haben, heißen sie eben Frühstücksrichtlinien. Noch vor der Brotzeit hat die EU das Handtuch geworfen: Es gibt einfach zu viele Lebensmittel. Um für alle ein europäisches Einheitsrezept auszuhandeln, wären ein paar Jahrhunderte nötig und eine Bereicherung für den Speiseplan wäre das nicht.
Ohne Wachtelpasteten-Richtlinie
Seitdem gilt: Was in einem EU-Mitgliedsland verkauft werden darf und der Gesundheit nicht schadet, darf in allen EU-Ländern verkauft werden. Das klappt ganz gut. Die meisten EU-Bürger kommen damit zurecht, dass italienische Salami anders schmeckt als deutsche oder ungarische. Wer sie nicht mag, muss sie ja nicht kaufen. Auch über Probleme mit französischen Wachtelpasteten ist nichts bekannt. Obwohl es keine EU-Wachtelpastetenrichtlinie gibt.
Die Frühstücksrichtlinien dagegen gibt es, und sie liegen der EU schwer im Magen, weil sie dauernd geändert werden müssen - so wie die Marmeladenrichtlinie, die lange vor dem österreichischen EU-Beitritt gemacht wurde. Aber warum muss es eine EU-Richtlinie für Marmelade geben, wenn man für die Semmel darunter keine braucht? "Wenn's eine Richtlinie mal gibt", meint Frau G., die sich da auskennt, "dann ist abschaffen schwieriger als behalten." Vor allem bei Lebensmitteln.
Als die EU vor Jahren eine Lockerung der Schokoladenrichtlinie diskutierte, gab es einen Aufschrei quer durch Europa. Verbraucherverbände protestierten und zehn französische Spitzenköche marschierten mit aufgepflanzten Kochmützen und ihrer Forderung ins Europaparlament: Rettet die Schokolade.
Zwar kritisieren alle gerne die Regelungswut der EU-Bürokraten. Aber wenn es ums Essen geht, haben wir lieber ein paar Vorschriften zu viel als zu wenig.
------------------------------
Die Paradeiser und die EU-Verfassung
Am 1. Januar 2007 übernimmt Deutschland für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft. Zu einem der Hauptanliegen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Wiederbelebung des Projektes EU-Verfassung gemacht. Die Bevölkerung der wichtigen EU-Mitgliedsländer Frankreich und Niederlande hatte den zur Volksabstimmung vorgelegten Entwurf abgelehnt. Ein zentraler Grund für die Skepsis war die Furcht vor der Regulierungswut der EU-Bürokraten. Deutschland sieht keine Bürgerbefragung vor. Aber es gab schon frühere Formen des Widerstandes.
Als Österreich der EU beitrat, schlug es Schlachten für die amtliche Beibehaltung österreichischer Qualitätsbegriffe. Paradeiser statt Tomate, Erdapfel statt Kartoffel, Marille statt Aprikose, Vogerlsalat statt Feldsaat - auch wenn viele Gesellschaftsschichten und Regionen niemals "Erdapfel" sagten und "Paradeiser", sondern immer "Kartoffel" und "Tomate". Seither verwenden auch diese Leute lieber die "österreichischen" Begriffe, ein Beispiel dafür, wie der Eintritt in ein großes, unheimliches Gebilde eine Flucht in heimatliche Werte auslöst.